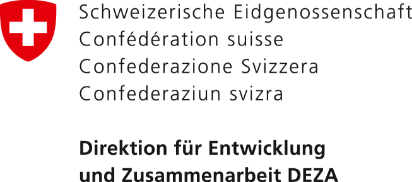Ohne biologische Vielfalt keine nachhaltige Entwicklung
Die Vielfalt an Arten und Ökosystemen auf unserem Planeten geht rapide zurück. Seit über 30 Jahren versuchen Staaten die fortschreitende Umweltzerstörung durch multilaterale Zusammenarbeit zu stoppen. Bislang jedoch mit wenig Erfolg. Ein neues globales Rahmenwerk mit konkreten Zielen und Indikatoren soll den Schutz und Wiederaufbau von Biodiversität neu beleben. Das wäre auch für die Agenda 2030 und die Erreichung der 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zentral.

Die «Rote Liste der gefährdeten Arten» der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) ist ein kritischer Massstab für den Stand der globalen Biodiversität – und um diese steht es schlecht. Die IUCN hat 147'500 Tier-, Pilz- und Pflanzenarten erfasst, wovon aktuell mehr als 41'000 vom Aussterben bedroht sind.
«Dass bestimmte Arten verschwinden, ist normal», sagt Bruno Oberle, Generaldirektor der IUCN. «Unser Planet ist kein Museum, sondern in stetigem Wandel begriffen. Aber aktuell schreitet dieses Verschwinden 100- bis 1000-mal schneller voran als in den vergangenen hundert Jahren.» Das führe dazu, dass ganze Ökosysteme kollabierten, wie zum Beispiel die fehlende Befruchtung von Obstbäumen in Neuseeland wegen des Bienensterbens oder die Wüstenbildung in Teilen Afrikas und Chinas. Oberle vergleicht die Ökosysteme mit dem Internet: «Einzelne Verbindungen können abbrechen, ohne dass das System versagt. Doch ab einem gewissen Punkt liegt das gesamte System flach.»
Wo genau diese Kipppunkte liegen, an welchen negative Rückkopplungen einsetzen, welche die Zerstörung unkontrollierbar beschleunigen, wisse man noch viel weniger als bei der Klimakrise. «Der drastische Rückgang an Biodiversität ist wahrscheinlich ein noch grösseres Risiko für die Menschheit als das Klima», sagt Oberle. «Nur merken die meisten von uns das derzeit noch nicht unmittelbar.» Die Prognosen sind jedoch alarmierend: Der UN-Weltbiodiversitätsrat (IPBES) hat in einem Bericht von 2019 festgehalten, dass bis zu einer Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind und viele schon in den nächsten Jahrzehnten für immer verloren sein könnten.
Zerstörte Ökosysteme führen zu Armut
Die Gründe für das aktuelle Massensterben sind offensichtlich: Die Zerstörung von Biodiversität hat meist keinen Preis. Wir verbrauchen deshalb weltweit so viel Ressourcen, dass dafür eineinhalb Planeten nötig wären. Würden alle so viel konsumieren wie in der Schweiz, bräuchte es sogar drei Planeten. Ähnlich wie beim Klima sind auch die Folgen der Biodiversitätskrise ungleich verteilt. Arme Haushalte, Kleinbäuerinnen und indigene Gruppen im Globalen Süden sind am stärksten davon betroffen – obschon sie am wenigsten Ressourcen verbrauchen.
Entwicklungsexpertinnen und -experten sind sich deshalb weitgehend einig: Ohne wirkungsvollen Schutz der Biodiversität sind die 17 Ziele einer nachhaltigen Entwicklung im Rahmen der Agenda 2030 nicht erreichbar. Die meisten hängen direkt von einer gesunden Umwelt ab; zerstörte Ökosysteme hingegen führen zu Armut und Ungleichheit.
Auf UN-Ebene ist die Sorge um den Rückgang der Biodiversität nicht neu. Am grossen Gipfel für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro von 1992 wurde nicht nur ein Rahmenwerk für die Klimafrage (UNFCCC) aus der Taufe gehoben, sondern auch eine Biodiversitätskonvention, die «Convention on Biological Diversity» (CBD). Es ist das wichtigste multilaterale Vertragswerk für den Schutz der Biodiversität.
Bis heute sind der Konvention 196 Vertragsstaaten beigetreten, darunter auch die Schweiz. Die USA haben die Konvention zwar unterschrieben, aber nie ratifiziert; sie sind lediglich als Beobachter dabei. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die biologische Vielfalt in ihren Ländern zu schützen, den Zugang zu genetischen Ressourcen und deren Nutzung gerecht zu regeln und Massnahmen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Biodiversität zu ergreifen.
Globale Zielsetzung mit beschränkter Wirkung
Im April 2002 wurde das Ziel formuliert, die Rate des Verlustes an biologischer Vielfalt bis 2010 signifikant zu reduzieren. Weil es wirkungslos blieb, wurde im Oktober 2010 in Nagoya ein globaler strategischer Plan für die Biodiversität 2011 bis 2020 beschlossen. Zentraler Teil dieses Rahmenwerks waren die 20 «Aichi Biodiversity Targets». Die Ziele umfassten den Waldschutz, die Eindämmung des Ressourcenverbrauchs und neue Naturschutzgebiete. Schädliche Subventionen sollten runtergefahren und die Biodiversitätsziele in nationale und lokale Entwicklungs- und Armutsreduktionsmassnahmen integriert werden. In der Schweiz verabschiedete der Bundesrat deshalb 2012 eine erste nationale Biodiversitätsstrategie, die 2017 in einem Aktionsplan mit Massnahmen konkretisiert wurde.
Im «Global Biodiversity Outlook» von 2020 wurden die Erfolge in Hinblick auf die Aichi-Ziele analysiert. Die Bilanz ist ernüchternd: Auf globaler Ebene wurde keines der 20 Ziele vollständig und nur sechs teilweise erreicht. Zudem bildeten nur 23 Prozent der nationalen Ziele die Aichi-Ziele in Bezug auf Ambition und Umfang ab. An der 15. Vertragsstaatenkonferenz (COP) in Montreal im Dezember 2022 wurde deshalb über ein neues globales Biodiversitäts-Rahmenwerk verhandelt (siehe Kasten zu «COP15»). Das übergeordnete Ziel besteht darin, den Verlust an Biodiversität bis 2030 zu stoppen und bis 2050 ein «Leben in Harmonie mit der Natur» zu sichern.
Durchbruch an Biodiversitätskonferenz COP15
Das Abschlussdokument der Biodiversitätskonferenz, die vom 07. bis 19.12.2022 in Montreal abgehalten wurde, ist von Politik, Zivilgesellschaft und Umweltschutzverbänden als wichtiger Durchbruch bewertet worden. Im Abkommen haben sich 196 Vertragsstaaten der «Convention on Biological Diversity» (CBD) auf ein neues Rahmenwerk mit 23 Zielen geeinigt. Darunter 30 Prozent der Land- und Meeresflächen bis 2030 für die Biodiversität zu erhalten. Die Wahrung der Rechte von indigenen Gruppen wird mehrfach erwähnt und deren zentrale Rolle für den Schutz der Artenvielfalt betont. Das Übereinkommen sieht zudem vor, dass umweltschädliche Subventionen, vor allem in der Landwirtschaft, aufgehoben werden. Grosse, transnationale Unternehmen sollen künftig eigene Auswirkungen auf die Biodiversität und Geschäftsrisiken aufgrund des Biodiversitätsverlusts rapportieren. Für die kommerzielle Nutzung von digitalen Sequenzinformationen genetischer Ressourcen (DSI) soll ein Fonds geschaffen werden, über welchen Staaten mit grosser Artenvielfalt, vor allem im Globalen Süden, entschädigt werden. Es gab jedoch auch Kritik: Die Delegation der Demokratischen Republik Kongo, einer der artenreichsten Staaten der Welt, warf der chinesischen Konferenzleitung vor, dass das Abkommen trotz Einwänden durchgepeitscht wurde und ohne ihre Zustimmung zustande gekommen sei.
Auch für die Schweiz eine Herausforderung
«Die Aichi-Ziele waren gut, haben aber die gewünschte Wirkung wegen der mangelhaften Umsetzung nicht erreicht», sagt Niklaus Wagner, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Sektion Rio-Konventionen beim Bundesamt für Umwelt (BAFU). «Es braucht für die neuen Ziele einheitliche Indikatoren zur Wirkungsmessung und eine verbesserte Berichterstattung und Überprüfung der Umsetzung.» Neue Biodiversitätsziele seien insbesondere in Kombination mit griffigen Indikatoren wirkungsvoll, weshalb die beiden Elemente gemeinsam verhandelt werden müssten.

Ein wichtiger Eckpunkt des neuen Rahmenwerks mit einer messbaren Zielvorgabe ist für Wagner das «30 by 30»-Ziel. Danach soll weltweit 30 Prozent der globalen Land- und Meeresflächen bis 2030 für die Biodiversität gesichert werden, u.a. durch die Ausscheidung von Schutzgebieten, durch die Revitalisierung von Flüssen und das Offenhalten von Wanderkorridoren, die der Vernetzung von Lebensräumen von Wildtieren dienen.
Der Aufbau dieser ökologischen Infrastruktur ist auch für die Schweiz eine Herausforderung. Aktuell liegt der Anteil an Biodiversitätsschutzgebieten bei 13,4 Prozent. Zielkonflikte sind vorprogrammiert, denn wo grosse Flächen zugunsten der Biodiversität geschützt werden, kann keine intensive Landwirtschaft mehr betrieben werden. Manche Staaten argumentieren, dass dies der Ernährungssicherheit zuwiderläuft. Zivilgesellschaftliche Organisationen wiederum kritisieren, dass ein solches Ziel zulasten derjenigen indigenen Gruppen gehen könnte, die in den Gebieten leben, die für die Erreichung des «30 by 30»-Ziels geschaffen werden sollen.
Steiniger Weg zur biodiversen Landwirtschaft
Die Landwirtschaft und das globale Ernährungssystem spielen für den Schutz der Biodiversität eine Schlüsselrolle. 70 Prozent des Biodiversitätsverlusts haben eine direkte Verbindung zu unserer Nahrungsmittelproduktion. 33 Prozent der weltweiten oberen Bodenschichten sind heute degradiert, was vor allem der Grünen Revolution und einer Landwirtschaft geschuldet ist, die auf exzessiven Gebrauch von Düngemitteln und Pestiziden beruht. 80 Prozent der globalen Waldrodung findet zugunsten von landwirtschaftlichem Nutzen statt.
Mehrere Aichi-Zielen betrafen deshalb explizit die Transformation der Landwirtschaft. Doch diese lässt bis heute auf sich warten. «Weiterhin kursieren Ideen, landwirtschaftliche Nutzungen auf gewissen Flächen zu intensivieren, um andere `stillzulegen` und zu schützen. Das halten wir für wenig nachhaltig und unsozial», sagt Simon Degelo, der das Dossier Saatgut und Biodiversität bei der Schweizer NGO Swissaid betreut. «Vielmehr sollte die Biodiversität innerhalb der Landwirtschaft erhalten und gefördert werden.»
Swissaid setzt deshalb bei Entwicklungsprojekten auf agrarökologische Praktiken. «Monokulturen, oft basierend auf hybriden Getreidesorten, die viel Dünger und andere chemische Inputs benötigen, sind nicht nur ein ökologisches Risiko, sondern auch ein wirtschaftliches», sagt Degelo. Ein einziger Schädling könne bei Monokulturen die ganze Ernte zerstören. «Diversität in der Landwirtschaft stärkt die Resilienz – auch gegenüber Klimaschocks.»
Entwicklungszusammenarbeit und Biodiversitätsziele
Das zeigt sich exemplarisch in einem Projekt in Boyaca, im Nordosten Kolumbiens, das durch die DEZA und die «Global Environment Facility» (GEF), einem globalen Fonds für den Naturschutz, unterstützt wird. Dort ging die landwirtschaftliche Produktion in den letzten Jahren drastisch zurück, weil durch einen intensiven Anbau von Kartoffeln die Bodenfruchtbarkeit zurückging und immer mehr Dünger und Pestizide eingesetzt wurden. In der Folge suchten die Menschen ein Einkommen in den Kohleminen, die im Naturschutzgebiet illegal errichtet wurden.

Swissaid half den Bäuerinnen und Bauern in sechs Gemeinden alte Pflanzensorten anzubauen und die Biodiversität in der Region durch nachhaltige Weidehaltung zu schützen. Anstelle von Kartoffelmonokulturen werden heute auch Mais, Weizen, Quinoa, Bohnen, Erbsen, Linsen und Kohl angepflanzt. Dadurch wird nicht nur die Vielfalt auf dem Acker gefördert, sondern auch eine gesunde Ernährung und die Unabhängigkeit von Importen. Für Degelo ist dies ein gutes Beispiel, wie Entwicklungszusammenarbeit konkret zur Erreichung der Biodiversitätsziele beitragen kann.
Das Projekt unterstützt zudem den Aufbau von bäuerlichen Saatgutbanken und Saatgutnetzwerken im Globalen Süden. «Denn für eine vielfältige Landwirtschaft ist auch vielfältiges Saatgut notwendig», sagt Degelo. «Bäuerinnen und Bauern müssen eine Wahl haben, doch in vielen Ländern besteht diese heute nicht mehr.» Mit Patenten würden Saatgutkonzerne zunehmend genetische Ressourcen privatisieren, insbesondere, wenn die Patente auch konventionell gezüchtete Sorten beträfen.
Besonders Länder des Globalen Südens würden dem Druck der Industrieländer und der Saatgutindustrie oft nachgeben und führten strenge Saatgutgesetze ein, welche das traditionelle bäuerliche Saatgut vom Markt verdrängen, so Degelo. Bei den Verhandlungen für ein neues Biodiversitäts-Rahmenwerk müsse deshalb auch das Recht der Bäuerinnen und Bauern geschützt werden, frei über ihr Saatgut zu verfügen.
Ungleicher Profit aus genetischen Ressourcen
Ein weiteres umstrittenes Thema ist das «Access and Benefit-Sharing» (ABS), also eine gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung von genetischen Ressourcen – zum Beispiel einer Heilpflanze für die Entwicklung von Medikamenten. Das Nagoya-Protokoll, das Teil des CBD-Mechanismus ist, sieht vor, dass Unternehmen, Forschungsinstitutionen und Staaten bilateral eine gerechte Abgeltung aushandeln. In der Praxis gestaltet sich das jedoch schwierig und laut Degelo fliessen bis heute praktisch keine Gelder zu den Herkunftsländern von genetischen Ressourcen.
Entwicklungsländer fürchten zudem, dass sich durch die Digitalisierung der ungleiche Profit aus genetischen Ressourcen in Zukunft noch verstärken könnte. Denn heute reicht oft bereits die digitale Sequenz des Erbgutes einer Pflanze in einer Datenbank, damit die Eigenschaften erforscht und kommerzialisiert werden können. Inwiefern die Regeln des Nagoya-Protokolls für die Nutzung physischer genetischer Ressourcen auch auf digitale Sequenzinformationen ausgeweitet werden können, darüber gehen die Ansichten der Staaten weit auseinander.
Für die Schweiz sei es wichtig, den Zugang zu diesen Informationen für die Forschung und zukünftige Innovationen nicht zu erschweren, sagt Niklaus Wagner vom BAFU. «Im Rahmen der Verhandlungen sucht die Schweiz aktiv praktikable Lösungsansätze, die auch den Bedürfnissen der Entwicklungsländer Rechnung tragen.»
Billionen für den Biodiversitätsschutz
Eine bis heute weitgehend unbeantwortete Frage in den internationalen Verhandlungen ist die Finanzierung. Wie stark sind einzelne Staaten für die Biodiversitätskrise verantwortlich und in welchem Ausmass beteiligen sie sich an der Finanzierung der Schutzmassnahmen? Das Umweltprogramm der UN (UNEP) hat 2021 berechnet, dass bis 2050 Investitionen von 8100 Milliarden US-Dollar notwendig sind, um die ineinander verschränkten Krisen des Klimas, der Biodiversität und des Landverlustes wirksam zu bekämpfen.

«Das tönt nach sehr viel», sagt IUCN-Generaldirektor Bruno Oberle, «sind aber nur einige Prozent des globalen Bruttosozialprodukts.» Zudem würde ein «Business as usual», bei dem die Zerstörung der Biodiversität im heutigen Mass fortschreitet, die Menschheit noch viel teurer zu stehen kommen. Denn rund die Hälfte des wirtschaftlichen Bruttosozialprodukts ist direkt abhängig von einer gesunden Biodiversität. So ist zum Beispiel die Nahrungsmittelproduktion auf Bestäuber wie Bienen angewiesen. Fallen sie weg, gibt es auch keine Ernten und Erträge mehr.
An den jährlich rund 700 Milliarden US-Dollar, die allein für den Biodiversitätsschutz notwendig sind, müssen sich laut Oberle alle beteiligen: die Staaten, die Wirtschaft, Entwicklungsagenturen und Stiftungen. Die «Global Environment Facility» (GEF), die von der Weltbank für Umweltprojekte in Entwicklungsstaaten eingerichtet wurde und deren Aufstockung eine wichtige Forderung von Ländern des Globalen Südens ist, werde zwar Teil davon sein, aber bei weitem nicht ausreichen.
Den grössten Hebel erkennt Oberle bei den öffentlichen Haushalten: «Derzeit werden jährlich 600 bis 700 Milliarden US-Dollar Subventionen für Biodiversitäts-schädigende Praktiken bezahlt.» Damit werden chemischer Dünger finanziert oder die Fleischproduktion unterstützt. «Wenn diese Gelder in regenerative Praktiken zum Aufbau von Biodiversität fliessen würden, dann könnten wir die globalen Biodiversitätsziele erreichen – trotz der enormen Herausforderungen», ist Oberle überzeugt.
Wir freuen uns auf ihren Besuch. Weitere Infos