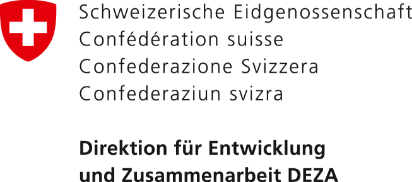«Die Menschenrechte müssen beim Schutz der Biodiversität geachtet werden»
Der afrikanische Kontinent ist reich an Tieren, Pflanzen und einzigartigen Ökosystemen. Für die Erhaltung der globalen Biodiversität spielt er eine Schlüsselrolle. Mariam Mayet, Direktorin des «African Center for Biodiversity» (ACB), warnt jedoch davor, dass Indigene und Kleinbäuerinnen zugunsten des Naturschutzes von ihrem Land vertrieben werden. Sie fordert eine grundsätzliche Systemkritik.

Frau Mayet, inwiefern sind die Länder Afrikas besonders auf den Schutz ihrer Biodiversität angewiesen?
Auf unserem Kontinent gibt es noch immer eine Fülle von intakten Ökosystemen und Landschaften; zum Beispiel Feuchtgebiete mit einem unglaublichen Reichtum an Vögeln. Aber wir beobachten einen rapiden Rückgang dieser Biodiversität, was vor allem mit einem neokolonialen Entwicklungsmodell und den globalen Kapitalflüssen zusammenhängt. Viele afrikanische Ökonomien sind exportorientiert und basieren auf der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen wie Öl, Erdgas, Kohle und Edelmetallen. Zugunsten der Industrialisierung und Entwicklung sollen diese natürlichen Ressourcen genutzt werden. So sieht es auch die «Agenda 2063» der Afrikanischen Union vor, eine Art Masterplan für die Zukunft des Kontinents. Verstehen Sie mich nicht falsch, auch wir wollen, dass sich Afrika entwickelt, aber indem die Biodiversität des Kontinents nachhaltig genutzt wird und die Gewinne in erster Linie den Menschen vor Ort zugutekommen.
Sie kritisierten die multilateralen Verhandlungen für ein neues globales Biodiversitätsabkommen in der Vergangenheit immer wieder scharf. Was ist ihre grösste Sorge?
Wir haben die planetaren Grenzen längst überschritten und stehen kurz vor einem ökologischen Kollaps. Doch wir sehen keine Anzeichen dafür, dass das neue Rahmenwerk dieser Dringlichkeit gerecht würde. Ich habe an zahlreichen Treffen teilgenommen, zuletzt im März 2022 als Beobachterin bei den Verhandlungen in Genf. Mir schien, dass die einzelnen Staaten vor allem gekommen waren, um ihre nationalen Interessen und diejenigen ihrer Industrien zu verhandeln und nicht ein starkes globales Rahmenwerk für den Planeten und die Menschheit. Wir müssen Regierungen in die Verantwortung ziehen, um unsere Existenz zu sichern und allen Menschen ein sinnvolles Leben zu ermöglichen. Das braucht Fantasie und eine Wirtschaft, die nicht mehr auf Wachstumssteigerung ausgerichtet ist. Anstatt die zentralen Treiber anzugehen, versuchen die Staaten aber wiederum marktbasierte Lösungen für die Krise zu finden, zum Beispiel durch «Biodiversity Offsets», mit welchen Biodiversitätsverluste kompensiert werden sollen. Dass Offsets nicht funktionieren, hat sich beim Klimaschutz gezeigt.
Ein zentrales Ziel des neuen Rahmenabkommens ist, 30 Prozent der Land- und Meeresfläche unter Schutz zu stellen, auch in Afrika. Sind Sie damit nicht zufrieden?
Wir sehen dabei die Gefahr, dass Regierungen nun denken: Lasst uns die 30 Prozent schützen, damit wir gleichzeitig den Rest weiterhin ausbeuten können wie gewohnt. Zudem könnten die 30 Prozent unter die Kontrolle von grossen Naturschutzorganisationen gelangen, die eigene Schutzgebiete initiieren und die teils Verbindungen zur Agrar- und fossilen Energieindustrie pflegen. Wir befürchten, dass lokale Gemeinschaften im Rahmen dieses Ziels vertrieben und an der Befriedigung ihrer elementaren Bedürfnisse gehindert werden könnten. Die Menschenrechte müssen beim Schutz der Biodiversität unbedingt geachtet werden. Das heisst, dass es nur mit Zustimmung der lokalen und indigenen Bevölkerungen zulässig ist, ein bestimmtes Gebiet unter Schutz zu stellen.
«Natur wird eingezäunt, gleichzeitig wird ein nicht nachhaltiger Tourismus gefördert und die Biodiversität kommerzialisiert.»
Sie kritisieren in diesem Zusammenhang die Tendenz zur «Fortress Conservation». Können Sie diese Kritik ein wenig erläutern?
Ein gutes Beispiel dafür ist die «Ngorongoro Conservation Area» in Tansania, ein Naturschutzgebiet, das an die Serengeti grenzt. Die Massai werden dort von der Regierung systematisch aus ihrem angestammten Lebensraum vertrieben. Sie haben den Fall vor den Ostafrikanischen Gerichtshof gebracht, um ihre Rechte zu verteidigen, aber die Richter sind der Argumentation der Regierung gefolgt. Wir beobachten vielerorts ähnliche Entwicklungen. Natur wird eingezäunt, gleichzeitig wird ein nicht nachhaltiger Tourismus gefördert und die Biodiversität kommerzialisiert. Dieses Erhaltungsmodell (Fortress conservation) hat in Afrika koloniale Wurzeln und eine lange Geschichte.
Eine weitere Kritik von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie dem ACB lautet, dass Grossunternehmen versucht haben, das Rahmenwerk nach ihren eigenen Interessen umzuschreiben. Wo genau erkennen Sie solche Tendenzen?
Ein Anzeichen dafür war der Pakt zwischen «Crop Life», einem Verband, der alle grossen Agrochemieunternehmen vertritt, und der Welternährungsorganisation (FAO), im Rahmen des «Food Systems Summit» von 2021. Auch werden Sekretariate von multilateralen Organisationen mit Leuten besetzt, die der Industrie nahestehen. Und wir beobachten ganz allgemein eine Kaperung des Biodiversitätsdiskurses. Zentrale Treiber der Umweltzerstörung werden bewusst verschleiert, obschon diese durch den UN-Weltbiodiversitätsrat längst wissenschaftlich belegt sind. Zum Beispiel der grossflächige Einsatz von hochtoxischen Pestiziden in der Landwirtschaft oder der exzessive Gebrauch von synthetischen Düngemitteln. Deshalb müssen wir die landwirtschaftliche Produktion und das Ernährungssystem schnellstmöglich transformieren.

Was wären konkrete Lösungsansätze, die in einem internationalen Rahmenabkommen verankert werden könnten?
Zum Beispiel die Transformation hin zu einem Ernährungssystem, das auf Agrarökologie basiert, mit hoher Diversität, natürlichen Inputs und langfristiger Erhaltung der Bodenqualität. Solche Systeme bringen soziale, ökologische und ökonomische Vorteile für die Gesellschaft. Wir fordern nicht, dass eine solche Transformation über Nacht geschieht, aber man könnte wenigstens einige Bausteine dafür einbauen. Auch in Hinblick auf Klimaschutz und -adaption sowie zur Stärkung der Resilienz von vulnerablen Gruppen wäre die Agrarökologie eine äusserst effektive Strategie. Dafür müssen jedoch die Machtverhältnisse verschoben werden – weg von wenigen Grosskonzernen, hin zu vielen lokalen, dezentralisierten Akteuren.
«Die wichtige Rolle von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen bei der Welternährung wird viel zu wenig berücksichtigt.»
Wurden solche Forderungen in den Verhandlungen zu einem neuen Biodiversitäts-Rahmenwerk aufgegriffen?
Nein, wir beobachten eher ein «Business as usual» und die Fokussierung auf falsche Lösungsansätze. Zum Beispiel auf «Genome editing», gentechnische Verfahren, um vermeintlich besseres Saatgut von Pflanzen herzustellen, die besser mit dem Klimawandel zurechtkommen sollen. Forderungen nach mehr Biotechnologie werden besonders von Saatgut- und Agrochemiekonzernen stark vorangetrieben und grosse Getreideexporteure wie Brasilien, Argentinien, die USA und Kanada unterstützen diesen Ansatz. Dagegen wird die wichtige Rolle von Kleinbauern und -bäuerinnen bei der Welternährung viel zu wenig berücksichtigt.
Das neue Biodiversitätsabkommen wurde durch die politischen Vertreter und Vertreterinnen von 196 Staaten ausgehandelt. Gab es darunter auch solche, die Ihre Forderungen aktiv unterstützten?
Leider haben wir auch von afrikanischen Staaten wenig Unterstützung erhalten. Bolivien war eines der wenigen Länder, das mit einem fortschrittlichen Vorstoss in der Vorbereitung des Rahmenabkommens auf sich aufmerksam gemacht hat. Es forderte, dass die Rechte der Natur anerkannt und in internationalem Umweltrecht festgeschrieben werden und dass die Verhandlungen weniger den Menschen ins Zentrum stellt. Es vertrat damit die Perspektive von indigenen Gruppen, die oft noch ein viel stärkeres Bewusstsein für die Verbundenheit von sämtlichem Leben auf Erden haben. Wir könnten für den Schutz der Biodiversität viel von ihnen lernen.
MARIAM MAYET ist Gründerin und Direktorin des «African Center for Biodiversity» (ACB) in Johannesburg. Die 2003 gegründete Organisation setzt sich für die Erhaltung von Biodiversität sowie für Ernährungssicherheit und -unabhängigkeit auf dem afrikanischen Kontinent ein. ACB ist Teil der «African CSOs Biodiversity Alliance» (ACBA), eine Vereinigung von über 80 zivilgesellschaftlichen Organisationen in Afrika, die sich für ein starkes und gerechtes Abkommen im Rahmen der Biodiversitätskonvention (CBD) einsetzen, unter anderem mittels Informationsveranstaltungen, Positionspapieren und Lobbying bei afrikanischen Regierungen.

Wir freuen uns auf ihren Besuch. Weitere Infos