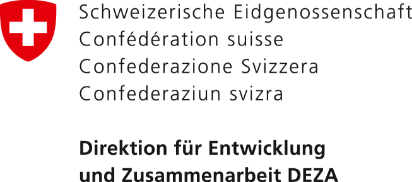Mit Tröpfchen und Tarifen gegen die Wasserkrise
Millionen Menschen in Zentralasien haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser – und Bäuerinnen verlieren Ernten, weil sie ihre Pflanzen während Dürren nicht ausreichend bewässern können. «Eine Welt» hat sich in Tadschikistan und Usbekistan auf die Spur der grenzüberschreitenden Ressource gemacht und nach einem nachhaltigeren Umgang damit gesucht.

Das tadschikische Dorf Lakkon liegt auf einer flachen, trockenen Landzunge, die auf drei Seiten von Kirgisistan umschlossen ist. Die Quelle der Trinkwasserversorgung für die 7500 Bewohnerinnen und Bewohner lag bis vor wenigen Jahren auf der kirgisischen Seite. Vor 1991 spielte dies keine Rolle, weil sämtliches Territorium zur Sowjetunion gehörte und durch die russische Regierung zentralistisch verwaltet wurde – auch die Wasserversorgung.
Nach der Unabhängigkeit der Sowjetrepubliken begann die kirgisische Seite jedoch Wasser für den Eigenbedarf zurückzuhalten. Die geteilten, grenzüberschreitenden Wasserläufe und Grundwasser an der Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgisistan sind seit Jahren Quellen des Konflikts (siehe Kasten). Ab 2015 floss nur noch während drei Stunden pro Woche Wasser über die Grenze nach Lakkon. Dieses wurde in einem Wasserreservoir gesammelt, das zehn Hähnen im Dorf versorgte, wo die Bewohner und Bewohnerinnen Kanister mit Wasser für den Haushalt auffüllen konnten. Oft reichte das nicht einmal aus, um den Trinkwasserbedarf zu decken.
Dann musste Wasser mit Lastwagen aus dem Landesinneren an die Grenze gekarrt werden. Wenn auch das nicht ausreichte, versorgten sich die Menschen bei stehenden Gewässern. Die Folge: eine Häufung von wasserbedingten Krankheiten, allen voran Typhus, ein Bakterium, das zu hohem Fieber, Durchfall und bei schlimmen Verläufen zum Tod führt.
Grenzkonflikte um Land und Wasser
Am 28. April 2021 brachen in Woruch, einer tadschikischen Enklave in Kirgisistan, bewaffnete Kämpfe um den Zugang und die Kontrolle einer Wasserentnahmestelle aus. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, 200 verletzt, rund 40'000 mussten fliehen. Seither kommt es im Grenzgebiet immer wieder zu Ausschreitungen. Als wir für diese Reportage Anfang April von Chudschand an die kirgisische Grenze fahren, treffen wir auf einen Streifen der Zerstörung: Hotels mit russgeschwärzten Fassaden, abgebrannte Spielcasinos, verbarrikadierte Häuserruinen, demolierte Tankstellen ohne Zapfsäulen. Bilder wie aus einem Kriegsgebiet. Am Vorabend unserer Fahrt durch den menschenleeren, dystopischen Grenzabschnitt bei Dostuk war ein 27-Jähriger tadschikischer Soldat von Unbekannten getötet worden. Beinahe die Hälfte der 970 Kilometer langen Grenze ist bis heute nicht demarkiert und umstritten. Im Zentrum der Konflikte steht immer wieder der Zugang zu Land und Wasser.
Selbstverwaltung für unterversorgte Landbevölkerung
«Als ich vor acht Jahren zum ersten Mal nach Lakkon kam, hatte die Gemeinde nicht nur keine Kontrolle über ihr Trinkwasser, sie war auch von einer maroden Infrastruktur abhängig», erzählt Rahbar Homidova vom «International Secretariat for Water» (ISW), das in Tadschikistan seit 2007 eng mit der DEZA zusammenarbeitet. Die kanadische NGO hat sich auf die Verbesserung der Trinkwasserinfrastruktur in Zentralasien spezialisiert. «Die Reservoirs, Pumpen und Rohre waren komplett vernachlässigt, niemand kümmerte sich mehr darum.»
Homidova und ihr Team machten den Menschen im Dorf einen Vorschlag: «Wir renovieren die marode Infrastruktur, entkoppeln die Reservoirs von der Quelle in Kirgisistan und bauen das Trinkwassersystem so aus, dass alle künftig während 24 Stunden am Tag fliessend Wasser haben.» Die Bedingung: Jeder und jede müsse sich finanziell beteiligen und den Betrieb nach Instandsetzung in die eigenen Hände nehmen. Und vor allem: Das Wasser habe künftig einen Preis.
Ein Paradigmenwechsel, denn Wasser ist in Tadschikistan kostenlos; lediglich der Service der Wasserbereitstellung durch die Behörden kostet etwas. Ein Service, der jedoch den meisten Bürgerinnen und Bürgern vorenthalten bleibt: Nur 40 Prozent der Bevölkerung auf dem Land haben Zugang zu sauberem Trinkwasser – und nur zwei Prozent zu Abwassersystemen.
Demokratisch organisierte Wasserverwaltung
2017 begann das ISW-Team die Reservoirs zu erneuern, neue Grundwasserlöcher zu bohren, Rohre zwischen Quelle und Reservoirs sowie Anschlüsse in die Haushalte zu verlegen, Pumpen zu installieren sowie Kapazitäten für die Kontrolle und Chlorierung des Wassers aufzubauen. Dafür wurden 325'000 US-Dollar investiert, wovon die DEZA rund zwei Drittel übernahm. Mit Ausnahme der ärmsten Haushalte beteiligten sich alle Dorfbewohner mit mindestens 600 Somoni (rund 70 Franken) an den Kosten für die Infrastruktur.
Die Verwaltung der Wasserversorgung wurde demokratisch organisiert: Ein achtköpfiges Team ist für den Betrieb der Anlage und für das Eintreiben der Wassertarife zuständig. Es wird von einem siebenköpfigen Managementboard überwacht, das wiederum Rechenschaft an hundert durch die Gemeinde gewählte Vertreter und Vertreterinnen ablegt. «Der Vollkostentarif für den Wasserverbrauch ist zentral», erklärt Homidova. «Er ist die Garantie für die längerfristige Instandhaltung des Systems». Rund 40 Prozent der Erlöse decken die Saläre des Betriebsteams; 60 Prozent werden für die Amortisation, die Instandhaltung und Gebühren eingesetzt.
Heute hat die Bevölkerung tatsächlich ununterbrochen Wasser – und bezahlt dafür pro Haushalt zwei US-Dollar pro Monat, etwa ein Prozent des durchschnittlichen Einkommens. Das sei gut tragbar, beteuern mehrere Dorfbewohnerinnen. Früher hätten sie manchmal bis zu 20 Dollar monatlich bezahlt, wenn sie Wassertrucks bestellen mussten. Homidova und ihr Team haben in Lakkon gezeigt: Durch Partizipation der Bevölkerung und einen bescheidenen Wassertarif lässt sich nicht nur eine verlässliche Trinkwasserversorgung aufbauen, sondern auch Geld sparen.
Dank Wasser öfter in der Schule
Seit 2007 haben Homidova und ihr Team in enger Zusammenarbeit mit der DEZA 15 Gemeinden im tadschikischen Teil des Ferghanatals mit einer selbstverwalteten Trinkwasserversorgung ausgestattet. 110'000 Einwohnerinnen und Einwohner profitieren heute davon. Sie übernehmen 20 bis 40 Prozent der Installationskosten, den Rest schiessen die Entwicklungspartner ein, wobei meist auch die Regierung noch mit einem bescheidenen Beitrag involviert ist. Priorität bei der Installation haben jeweils Schulen, Spitäler und Gesundheitszentren.
Rund 50 Kilometer nördlich von Lakkon, in der Gemeinde Mehrobod, hat die Bevölkerung seit 2019 eine eigene Trinkwasserversorgung. Yodgoroy Dehqonova, die Schulleiterin der Gemeinde, erzählt, dass die 600 Schülerinnen und Schüler früher Wasser in kleinen Flaschen mit in die Schule bringen mussten, damit die Lehrerinnen die Kreide von der Tafel waschen konnten. Auf dem gesamten Schulareal gab es kein fliessendes Wasser. Viele Kinder seien damals regelmässig wegen Durchfall ausgefallen, erzählt die Lehrerin.
Heute steht auf dem Vorhof des alten Schulgebäudes ein 100-Liter Wassertank auf einer Betonstelze, mit dem vier Wasserhähnen an einem zentralen Brunnen gespiesen werden. Jeden Morgen, wenn die Kinder in die Schule kommen, waschen sie sich die Hände mit Seife. «Sie fehlen weniger und können sich besser auf die Schule konzentrieren», sagt Dehqonova. Das neue Trinkwassersystem versorgt nun 1450 Haushalte, drei Schulen, einen Kindergarten und eine Krankenstation.
«Es braucht einen Bewusstseinswandel»
Für eine Verbesserung der Lebensumstände reiche eine neue Infrastruktur jedoch nicht aus, sagt Homidova vom ISW. «Es braucht auch einen Bewusstseinswandel.» Noch vor wenigen Jahren hätten ihr Mitarbeitende des für Wasser zuständigen Ministeriums versichert, dass Seife zum Händewaschen unnötig sei. Im Rahmen des Projekts werden deshalb auch Beamte und Lehrerinnen im Umgang mit Wasser und Hygiene geschult. Langfristiges Ziel der ISW und der DEZA: Dass die Regierung selbst in solche Systeme und das Bewusstsein für Hygiene und Gesundheit investiert.

Doch die Reform der Trinkwasserversorgung lässt auf sich warten: Bürokratie und Korruption sind gross, Entscheidungen brauchen lange und noch fehlt vielerorts die Offenheit, neue Wege zu gehen. Zudem hat Wasser für die Landwirtschaft und Stromproduktion für die Regierung erste Priorität. Beides sind wichtige Exportgüter. Das Nachsehen hat vor allem die in Armut lebende Bevölkerung auf dem Land.
Eigentlich wäre Tadschikistan ein Wasserschloss: Über 90 Prozent der Landfläche sind Berge mit wasserreichen Gletschern, wo über 900 Flüsse entspringen, die länger als zehn Kilometer sind. Davon kommt jedoch im tiefgelegenen Ferghanatal im Norden, wo ein Grossteil der Bevölkerung lebt, wenig an. Hier ist Tadschikistan vor allem vom Fluss Syrdarja abhängig, der im hohen Tian Shan-Gebirge zwischen Kirgisistan und Usbekistan entspringt und durch Tadschikistan, Usbekistan und Kasachstan mäandriert, bevor er sich in einen von zwei noch existierenden Zipfeln des Aralsees ergiesst.
Das Tal ist trotz Trockenheit und Temperaturen von über 45°C im Sommer und -20°C im Winter äusserst fruchtbar: Baumwolle, Obst, Gemüse, Weizen und Reis werden hier angepflanzt. Durch ein ausgeklügeltes System aus Kanälen und Pumpstationen, welches russische Ingenieure in den 1960er- und 70er-Jahren gebaut hatten, werden bis heute Felder bewässert und zum Blühen gebracht. Doch genauso wie beim Trinkwasser implodierte 1991 mit der Sowjetunion auch die Wartung der Bewässerungsinfrastruktur. Kriege brachen aus, öffentliche Einrichtungen wurden geplündert; Stahlrohre, Ersatzteile und Werkzeuge verkauft. Heute trifft man vielerorts in Tadschikistan auf löchrige und verrostete Rohre, auf defekte Pumpen und ausrangierte Bagger aus Sowjetzeiten, die einst für die Kanalreinigung genutzt wurden.
Marode Pumpen und fehlende Expertise
In der Nähe von Chudschand, der Hauptstadt der Provinz Sughd im tadschikischen Teil des Ferghanatals, besichtigen wir die Pumpstation Dehnioy, die in den 60er-Jahren gebaut wurde. Wasser aus dem Syrdarja-Fluss, das über den Kairakkum-Stausee hierhin gelangt, wird von sieben mächtigen Pumpen in höher gelegene Bewässerungskanäle gepumpt. Tausende von Bauern bewirtschaften damit rund 10'000 Hektaren Land. Hojiboer Karimjon ist der Chefoperateur der Anlage und arbeitet seit 1977 hier. Der 67-Jährige war bereits in Pension, kehrte jedoch wieder zurück, weil gut ausgebildeter Nachwuchs fehlt, der die Pumpen, Schleusen und Kanäle aus Sowjetzeiten bedienen, warten und reparieren könnte.
Karimjon gehört zu einem Heer von erfahrenen Ingenieuren und Technikern, die – verteilt über ganz Zentralasien – ihr Bestes geben, um die alten Pumpen am Laufen zu halten. Das funktioniert nicht immer. Vor vier Jahren sind hier zur Erntezeit gleich sechs Pumpen ausgestiegen. Die Folge waren weitverbreitete Ernteausfälle. Die Situation hat sich verbessert seit die Schweiz 2019 zwei neue Pumpen finanzierte, die zugleich leistungsfähiger, stromsparender und zuverlässiger sind.

Die Bäuerin Shohista Tursynmurodova weiss aus eigener Erfahrung, wie verheerend der Ausfall einer grossen Wasserpumpe zur falschen Zeit sein kann. Wir treffen sie am Rand eines dicht mit Winterweizen bewachsenen Feldes im Distrikt Jabbor Rasulov. Sie erinnert sich an den 5. Juni 2021, als hier die Wasserprobleme begannen: Die Böden waren aufgrund der Dürre trocken und die Wasserstände in den Reservoirs und Flüssen tief. Dann stieg auch noch die Pumpe aus, welche den Kanal mit dem Bewässerungswasser für die hiesigen Felder speist. Über 350 Hektaren Land waren davon betroffen. «Wir sind im Sommer komplett von gepumptem Wasser aus den Kanälen abhängig», erzählt die Bäuerin. «Und die Pumpe war einen ganzen Monat ausser Betrieb.»
Zugute kam ihr, dass sie Vorsteherin einer «Water User Association» (WUA) ist. 67 Farmbetriebe mit 793 Hektaren Land und über 1400 individuelle Wassernutzende haben sich darin für die Verwaltung des Wassers in der Region zusammengeschlossen. Die WUAs sind Teil des «National Water Resource Management»-Projekts (siehe Kasten), das durch die DEZA finanziert und von einem NGO-Konsortium umgesetzt wird.
Spezialisten und Spezialistinnen des Projekts unterstützten Tursynmurodova und ihre Vereinigung während der Krise mit technischem und organisatorischem Know-how. Sie analysierten die Bodenbeschaffenheit, berechneten darauf basierend die minimal notwendigen Bewässerungsmengen für unterschiedliche Saaten und stellten Bewässerungspläne auf. Mit den Behörden vereinbarten sie, dass Wasser von einem höher gelegenen Reservoir, 25 Kilometer entfernt, über Gravitation in die leeren Kanäle geleitet wird.
Frauenstimmen für nationale Wasserreform
Im Rahmen des «National Water Resource Management Project» (NWRMP) arbeitet die DEZA eng mit der Regierung Tadschikistans an einer nationalen Wasserreform und berät bei der Ausarbeitung neuer Gesetze und Politiken. Die Reformen zielen darauf ab, die Wasserbewirtschaftung von einem administrativen und sektoralen Ansatz zu einem integrierten Wassermanagement weiterzuentwickeln, das auf dem Prinzip von Flusseinzugsgebieten basiert – ein Ansatz, den die DEZA in all ihren Wasserprojekten in Zentralasien verfolgt. Implementiert wird das Projekt durch Helvetas, ACTED, GIZ und den lokalen Partner Sarob. 2020 wurden fünf «River Basin Organisations» im Ministerium für Wasser und Energie gegründet. Die NGOs bringen dort die Interessen aus der Zivilgesellschaft in die nationale Wasserplanung ein, besonders die Stimmen der Frauen, die sich in einem eigenen «Women Basin Council» organisiert haben. Frauen leiden in Zentralasien am stärksten unter dem Wassermangel, auch weil viele Männer als Gastarbeiter in Russland tätig sind und sie oft allein für Haushalt und Landwirtschaft verantwortlich sind. Trotzdem fehlen Frauenstimmen heute meist noch bei politischen Entscheidungen zum Umgang mit der lebenswichtigen Ressource.
«Wir sind es gewohnt, zu uns selber zu schauen»
Trotz der Unterstützung musste Tursynmurodova am Ende mitansehen, wie sich ein Teil der Baumwollkapseln nicht ausbilden konnte. Nur wenn diese von allein aufplatzen und die weissen Fasern hervorquellen, kann die Baumwolle später geerntet werden. «Obschon ich mehr Dünger und neue Techniken einsetzte, verlor ich aufgrund des Wassermangels etwa 20 Prozent meiner Ernte», erzählt Tursynmurodova. Danach gefragt, ob sie sich Hilfe durch die Regierung gewünscht hätte, antwortet die Bäuerin: «Es gibt Dinge, die wir besser verstehen als die Regierung. Wir sind es gewohnt, zu uns selbst zu schauen.»
Nodir Muhiddinov arbeitet im Rahmen des Projekts für die Schweizer NGO Helvetas eng mit den Bäuerinnen und den Behörden zusammen. Er sagt: «Bislang lautete die Devise in unserem Land meist: Lasst uns einfach die Kapazitäten erhöhen, mehr Wasser aus Flüssen ableiten oder neue Grundwasser erschliessen. Aber das ist nicht nachhaltig.» Bis heute fehle ein nachhaltiges und integriertes Wassermanagement, das sich nach hydrologischen und ökonomischen Realitäten richte.
Er macht ein Beispiel: Aufgrund des hohen Marktpreises hätten in den vergangenen Jahren viele Bauern um Chudschand begonnen, Reis anzupflanzen. «Aber Reis braucht für diese Gegend viel zu viel Wasser; wir müssen diversifizieren und die Getreide den tatsächlichen Wasserverfügbarkeiten anpassen.» Hinzu kommt: Die Bevölkerung wächst und die Regierung will zusätzliches Land erschliessen. Wenige Kilometer von Chudschand soll inmitten der Wüste die neue Stadt «Saykhun» entstehen. Das Wasser für Landwirtschaft und Haushalte wird dem fünf Kilometer entfernten und 200 Meter tiefer gelegenen Syrdarja entnommen.
Zusätzliche Wasserengpässe sind absehbar – und Stromengpässe ebenso. Die vielen alten und ineffizienten Pumpen verschlingen Unmengen an Strom. Daher kommt es oft zu Versorgungsunterbrüchen. Zudem können die Pumpstationen meist nicht für den Strom bezahlen, was die ohnehin hohen Schulden der Regierung weiter in die Höhe treibt.
Usbekistan: Reich an Gas und Mineralien, arm an Wasser
Die Reise von Chudschand, im tadschikischen Teil des Ferghanatals, an die Grenze zu Usbekistan führt entlang einer schnurgeraden Strasse durch eine karge, über weite Strecken menschenleere Steppe. Hie und da tauchen Hirten mit breit gestreuten Schafherden auf; einzelne Tiere verlieren sich auf der Strasse und zwingen stotternde Trabis zum Abbremsen.
Nach dem Grenzübergang bei Oybek werden die Strassen besser, die Felder grösser und die Autos moderner – die meisten stammen vom staatseigenen Chevrolet-Werk in Asaka im Ferghanatal. Shavkat Mirziyoyev, der 2016 als Nachfolger des autoritären Islam Karimov an die Macht kam, hat zur Überraschung vieler einen Reformkurs eingeleitet. Seine Regierung hat die Visumpflicht für viele Staaten aufgehoben, eine Reform des Wassersektors initiiert, Spannungen mit Tadschikistan zum geplanten Ausbau von Wasserkraftwerken abgebaut und Vereinbarungen zu Grenzdemarkationen unterzeichnet.
Das Land ist wirtschaftlich aufstrebend und reich an Gas, Öl, Gold und Kupfer. Doch an einer Ressource mangelt es, wie fast nirgends sonst: Wasser. Nur 20 Prozent des Landesverbrauchs kann Usbekistan aus eigenen Quellen decken, der Rest kommt aus den Bergen Kirgisistans, Tadschikistans und Afghanistans.
Während der Sowjetunion bauten Zwangsarbeiter tausende Kilometer an Bewässerungskanälen, um der trockenen Steppe Usbekistans Landwirtschaftsfläche abzuringen. Dafür wurde der Fluss Amudarja angezapft, die zweite zentrale Lebensader Zentralasiens, welche das weite Flachland Usbekistans – von Samarkand bis hin zum Aralsee – mit Wasser versorgt. 80 Prozent der Landwirtschaftsfläche wurden für den Anbau von Baumwolle genutzt. Für ein Kilo Baumwolle werden rund 1800 Liter Wasser allein für die Bewässerung eingesetzt; der Fussabdruck mit indirektem Wasserverbrauch beträgt sogar 4460 Liter pro Kilo.
Wasserdefizite gefährden Ernährungssicherheit
Die Flüsse Usbekistans wurden von der Baumwolle regelrecht ausgesaugt und das Wasser als weisse Faser in die Welt exportiert. Die Folge: Ab den 80er-Jahren floss nur noch zehn Prozent der ursprünglichen Wassermenge in den Aralsee. Dort, wo einst der weltweit viertgrösste Binnensee mit einem diversen Ökosystem und einer profitablen Fischereiindustrie lag, findet sich heute eine versalzene, pestizid-belastete Wüste, in der aufgelaufene Fischkutter vor sich hinrosten. Die UNO nannte es einer der grössten Umweltkatastrophen der Menschheit.

Zwar wurde der Anteil Baumwolle an der Gesamtlandwirtschaft mittlerweile auf 25 Prozent reduziert, trotzdem leidet Usbekistan bis heute unter akutem Wasserstress und gehört zu den Staaten mit der geringsten Verfügbarkeit von Frischwasser pro Kopf. Die Klimakrise verschärft die Situation weiter. Hitzewellen und Trockenperioden dauern länger, der Bewässerungsbedarf steigt.
Gleichzeitig schmelzen die Gletscher in Kirgisistan und Tadschikistan, was kurzfristig zwar zu mehr Wasserabfluss führt, mittel- und langfristig jedoch Einbussen mit sich bringen wird. Bis 2050 zwei bis fünf Prozent weniger Wasser im Syrdarja und 10 bis 20 Prozent weniger im Amudarja, so die Prognosen des hydrometeorologischen Diensts Usbekistans. Die zunehmenden Wasserdefizite gefährden die Ernährungssicherheit und die nachhaltige Entwicklung der 35 Millionen Menschen im Land.
Um Wasser zu sparen, gibt es vor allem einen Hebel: die Landwirtschaft, die für 90 Prozent des nationalen Wasserverbrauchs verantwortlich ist. Das Sparpotenzial allein durch die Verbesserung der Infrastruktur ist riesig: 77 Prozent der Kanäle sind offen und nicht betoniert; rund 40 Prozent des Wassers kommt nie auf dem Feld an. Es versickert in den Erdbeeten der Kanäle oder verdunstet auf dem Weg. Und selbst wo die Kanäle befestigt sind, ist der Beton oft brüchig. Geschätzte 65 Prozent müssten erneuert werden.
Zweites grosses Problem: Nach wie vor werden die meisten Felder mittels Bewässerungskanälen geflutet, was äusserst ineffizient ist und den Böden schadet. Das stehende Wasser verdunstet, wodurch Salz zurückbleibt, das sich akkumuliert. Und das überschüssige, versickernde Wasser drückt den Pegel der Grundwasserquellen nach oben. Da auch dieses Wasser infolge von hohen Temperaturen und Verdunstung oft einen hohen Salzgehalt hat, versalzen die Böden dadurch zusätzlich von unten. Über die Hälfte der bewässerten Böden sind mittlerweile versalzen. Mancherorts, wo die Böden von einem weissen Schimmer überzogen sind, kann man das von blossem Auge sehen. Dabei gäbe es bei der Bewässerung durchaus Alternativen.
Die Tröpfchenpionierin
Nasiba Kholmirzaeva gehört zu den Pionierinnen, die in der Bewässerung neue Wege gehen. Sie empfängt uns in der Nähe von Navoji im Zentrum Usbekistans, auf halber Strecke zwischen den beiden historischen Städten Samarkand und Buchara. Am Rand eines gepflügten Feldes hat sie unter Maulbeerbäumen ein Schattensegel und einen Tisch installiert. Die Frau Mitte fünfzig spricht laut und selbstbewusst. Sie trägt goldene Fingerringe und eine klobige Metalluhr.


Kholmirzaeva ist Unternehmerin; sie steht nicht selbst im Feld, sondern managt den Betrieb von hier aus über ihr Smartphone, das während des Gesprächs andauernd fiept. «Meinem Mann gebe ich morgens Anweisungen, damit er weiss, was er tagsüber zu tun hat», sagt sie und lacht laut. Die ehemalige Biologielehrerin begann vor 20 Jahren mit dem Anbau von Baumwolle. Ihre Arbeiter gruben Bewässerungsrinnen auf dem Feld und legten sie mit Plastikfolie aus. Über Schleusen entlang eines Kanals am Rand der Felder wurden die Böden regelmässig geflutet. Das überschüssige Wasser floss über Entwässerungskanäle an den Seiten wieder ab und versickerte oder floss in die Flüsse zurück.
«Als ich vor 20 Jahren anfing, hatten wir rund 30 Prozent mehr Wasser zur Verfügung», sagt Kholmirzaeva. «Die Situation hat sich seither stark verschärft.» Sie gehörte zu den ersten in der Region, die auf Tröpfchenbewässerung umstellten. Vor zwei Jahren beauftragte sie ein Unternehmen auf 50 Hektaren Schläuche zu verlegen. Seither steht neben einem kleinen, offenen Wasserreservoir am Rande des Feldes eine mobile Pumpe auf einem Anhänger. Darüber werden die Schläuche im Feld mit Wasser gespiesen, über deren Auslässe bei konstantem Druck Wasser an die Stellen der Pflanzen tropft.
Anstatt die Felder mit Wasser zu fluten, wird nur so viel Wasser eingesetzt, wie der Boden aufnehmen kann und die Pflanzen für ihr Wachstum benötigen. «Heute brauche ich für dieselbe Fläche weniger als die Hälfte des Wassers», erzählt sie. «Davon profitieren auch die Böden, die früher oft matschig waren.»
App schafft Transparenz und spart Geld
Kholmirzaeva gehört zu einer Gruppe von 13 Bäuerinnen und Bauern, die Trainings besuchten, mit welcher die DEZA diese bei der Umstellung auf wasserschonende Technologien unterstützt. Agronominnen und Hydrologen erklärten ihr, wie Tröpfchenbewässerung funktioniert, was es bei der Installation der Pumpen, Schläuche und «Driper» (Auslässe) zu beachten gibt und wie die nötigen Wassermengen berechnet und den verschiedenen Pflanzen angepasst werden. Der Aufwand für die anfängliche Installation ist beträchtlich: Für einen Hektar Baumwolle müssen rund elf Kilometer Schläuche verlegt und später für die Ernte wieder eingesammelt werden.
Die Trainings sind Teil eines grösseren Projekts für mehr Nachhaltigkeit im Wassersektor, das die DEZA gemeinsam mit dem Wasserministerium Usbekistans umsetzt. Unter anderem hat das Projektteam eine App entwickelt, auf der Interessierte auch ausserhalb der Trainings wichtige Informationen zu Anbietern von Bewässerungssystemen, zu technischen Fragen und zu Subventionen durch die Regierung finden. Diese unterstützt seit 2019 die Installation der Systeme mit 1000 US-Dollar pro Hektare, was etwa 40 Prozent der Kosten entspricht.
Über eine Telegram-Gruppe, die mit der App gekoppelt ist, können sich Bauern zudem über ihre Erfahrungen austauschen, Produzenten und Beamte direkt kontaktieren und Experten um Rat fragen. Kholmirzaeva nutzte diese Möglichkeit ausgiebig: «Als sich das Prozedere hinzog, habe ich den verantwortlichen Beamten auch nachts noch Nachrichten geschickt und sie angerufen – solange, bis ich die Subventionen endlich auf meinem Konto hatte.» Andere sahen dies und stellten ihre Forderungen für die Umstellung genauso selbstbewusst. Die App schafft etwas Transparenz in einem notorisch intransparenten Bereich, wo gesicherte Daten oft nur schwer zugänglich sind und die Korruption blüht.
Die Umstellung hat sich für Kholmirzaeva auch wirtschaftlich gelohnt: «Früher brauchte ich im Sommer zehn Arbeiter, um die Felder zu bewässern, heute reichen zwei.» Nach den anderen acht Mitarbeitenden gefragt, antwortet sie, dass diese leicht Arbeit auf anderen Feldern gefunden hätten. Weiter spare sie Ausgaben für Diesel, weil sie den Traktor praktisch nicht mehr benötige. Und auch die Ausgaben für Dünger seien gesunken, seit sie diesen dem Wasser beimischt und gezielter verteilt. «Ich konnte meine Profite in den beiden letzten Jahren um 30 bis 40 Prozent steigern», erzählt die Unternehmerin. Der Erfolg spricht sich herum: Letztes Jahr haben gleich mehrere Bauern im Distrikt ihre Bewässerung umgestellt.
Schulung gegen den Tröpfchenfrust
Die Regierung hat grosse Ambitionen: Bis 2030 sollen 50 Prozent der Landwirtschaftsfläche mit wassersparender Technologie bewirtschaftet werden. Heute sind es erst sechs Prozent. Laut Birodar Burkhonjonov, Koordinator des DEZA-Projekts für ein nachhaltiges, integriertes Wassermanagement, sind in den vergangenen Jahren rund 20 nationale Produzenten von Tröpfchentechnologie und hundert Serviceanbieter entstanden. Die Nachfrage übersteige derzeit das Angebot, die meisten Anlagen würden nach wie vor importiert.


Trotz Boom fehle es vielerorts aber noch an Wissen. «Die Wartung der Anlagen ist eine grosse Herausforderung – und der Frust bei den Bauern gross, wenn Pumpen nach kurzer Zeit nicht mehr funktionieren oder die Driper durch auskristallisierten Dünger verstopfen», sagt Burkhonjonov. Um Wissen und Kapazitäten aufzubauen, arbeitet sein Team deshalb eng mit der Regierung zusammen. 18 Lehrer werden derzeit geschult, um in neun Colleges im ganzen Land Servicetechniker für wassersparende Technologien auszubilden. Vergangenen Herbst hat der einjährige Lehrgang mit 46 Studierenden in vier Pilotcolleges begonnen.
Eine Schlüsselrolle in der noch jungen Tröpfchenrevolution nehmen die landesweit 152 für die Bewässerung zuständigen Verwaltungsbüros auf Distriktebene ein. Sie kontrollieren Knotenpunkte des Kanalsystems und sind für die gerechte und behördlich beglaubigte Wasserverteilung an die Bauern zuständig. Dadurch sind sie Schnittstellen zwischen Wassernutzern, regionalen Behörden und nationalen Ministerien.
Im Rahmen des Projekts wurden sie zu einer Art «Wissenshub» für effiziente Bewässerungstechnologien umgerüstet. Bäuerinnen des jeweiligen Distrikts finden dort seit Kurzem Informationen und Beratung und sie können vor Ort gleich einen Antrag auf Subventionen stellen. In den Büros werden zudem wichtige Daten für die landesweite Wasserallokation aufgezeichnet, bislang meist manuell und mit Instrumenten, die teils über 40 Jahre alt sind. 18'000 Wassermesser sind in den Kanälen des Landes verbaut, doch erst 3000 senden automatisiert Daten an ein nationales Wassermanagement-Informatiksystem. Bis 2023 sollen alle mit automatisierten Sensoren ersetzt werden.
Das Gehirn der Wasserreform
In Zukunft sollen alle in den Distriktbüros aufgezeichneten Daten an die Server des «Information Analytical Resource Center» (IARC) geschickt und dort ausgewertet werden. Die Server stehen etwas versteckt in einem unscheinbaren Bau aus Sowjetzeiten im Zentrum der Dreimillionen-Metropole Taschkent. Hier arbeiten Ökonominnen, Mathematiker und Softwareingenieure an der Zukunft des Wassermanagements Usbekistans.

© Samuel Schlaefli

«Wir brauchen unbedingt bessere Datengrundlagen und dafür ist die Digitalisierung zentral», sagt Omina Islamova, die das Projekt für nachhaltiges Wassermanagement leitet. Monatelang hat sie mit Ministerien verhandelt, Konzepte erarbeitet und Budgets erstellt. 2017 war es so weit: Per Dekret des Präsidenten und mit finanzieller Unterstützung der Schweiz wurde das IARC als integraler Bestandteil des Ministeriums für Wasserressourcen gegründet.
Künftig soll jederzeit ersichtlich sein, für welche Zwecke an welchen Orten Wasser genutzt wird, wo Engpässe auftauchen und wie diese durch Überschüsse in anderen Regionen kompensiert werden können. Auch Daten aus den 1688 Pumpstationen im Land sollen einfliessen und die Messungen der 2300 «Taucher», welche die Pegel der Grundwasserquellen anzeigen, die auch in Hinblick auf die Versalzung der Böden wichtig sind. Islamova und ihr Team haben in den Büros des IARC eine Art digitales Gehirn für Usbekistans Wasserreform aufgebaut. «Wir haben auf nationaler Ebene eine Institution geschaffen, welche ein nachhaltiges, integriertes Wassermanagement aktiv vorantreibt», sagt sie. «Das ist ein wichtiger Beitrag für die Zukunft Usbekistans – darauf bin ich stolz!»
Wir freuen uns auf ihren Besuch. Weitere Infos