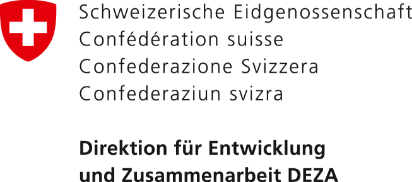«Entwicklung ist die Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen»
Die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit wurde 2020 für die kommenden vier Jahre neu ausgerichtet. «Eine Welt» wollte von der Entwicklungsökonomin Isabel Günther und dem Entwicklungssoziologen Elísio Macamo wissen, was gute Entwicklungspolitik ausmacht und inwiefern die Schweizer Strategie einer solchen entspricht.
Herr Macamo, Sie sind in Mosambik aufgewachsen und haben immer wieder zu Ihrem Herkunftsland geforscht. Die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit ist seit 1979 in Mosambik aktiv. Was hat sie dort bis heute bewirkt?
Elísio Macamo: Was die Schweiz in Mosambik macht, ist durchaus sinnvoll. Sie hat eine starke Präsenz, neuerdings vor allem im Bereich der Friedensstiftung und der Mediation. 2019 hat sie nach dem Zyklon Idai humanitäre Hilfe geleistet. Aber ich habe Mühe mit Ihrer Frage, weil ich mich weigere, diese Aktivitäten als Entwicklungsleistung zu betrachten. Zwar können Projekte in der Gesundheitsförderung eine positive Wirkung haben, wie die Reduktion von Infektionskrankheiten. Aber das bringt Länder nicht in eine Position, in welcher sie ihre Probleme selbst definieren und nachhaltig lösen können. Der Begriff «Entwicklungszusammenarbeit» beschreibt für mich deshalb vor allem einen internationalen Apparat, der Geld ausgibt für bestimmte Dinge, die diesen Apparat am Leben erhalten. Ich meine das nicht zynisch. Aber es gibt eine Marktnische, die mit der Überzeugung bedient wird, etwas Gutes für die Welt tun zu wollen.
Frau Günther, stimmen Sie Herrn Macamo zu? Führt Entwicklungszusammenarbeit in vielen Fällen gar nicht zu Entwicklung?
Isabel Günther: Es kommt natürlich darauf an, was wir unter Entwicklung verstehen. Wenn wir darunter zum Beispiel die Verbesserung der Gesundheit und den besseren Zugang zu Bildung verstehen, dann gibt es viele Organisationen, die positiv dazu beitragen. Wenn wir Entwicklung aber nur auf makroökonomischer Ebene betrachten und schauen, ob die Entwicklungszusammenarbeit ganze Staaten in die Lage bringt, sich selbst nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln, so leistet sie kaum einen Beitrag. Das zeigen auch makroökonomische Studien. Die Summen, die für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden, sind dafür viel zu gering. Sie betragen weltweit rund 150 Milliarden Dollar pro Jahr – das entspricht dem Umsatz von zwei grossen international tätigen Schweizer Unternehmen.
Ein Tropfen auf den heissen Stein also, wenn es um die Bekämpfung von globaler Ungleichheit und Armut geht?
Isabel Günther: Nein, ich sehe das nicht so pessimistisch, denn Entwicklung kann auch auf der Mikroebene stattfinden. Da bin ich ganz Schülerin des indischen Entwicklungsökonomen Amartya Sen, der unter Entwicklung vor allem die Befähigung des Einzelnen versteht, sein Leben selbst zu gestalten. Wenn Kinder besseren Zugang zu Gesundheitsleistungen und Schulen haben, dann haben sie später auch mehr Möglichkeiten in ihrem Leben.
Trotzdem stellt sich hier eine Grundsatzfrage: Wäre es nicht viel effektiver, Handelsbarrieren für Staaten des globalen Südens abzubauen, Schuldenrückzahlungen zu tilgen oder Steuergerechtigkeit herzustellen, anstelle mit einzelnen Projekten selektiv bestimmte Gruppen kurzfristig zu unterstützen?
Isabel Günther: Natürlich wäre eine globale Vermögenssteuer sehr effektiv für die Armutsbekämpfung. Die 2000 Reichsten auf dieser Welt verfügen über dasselbe Vermögen, wie die 4,6 Milliarden Ärmsten. Wenn man die Vermögen der reichsten ein Prozent der Weltbevölkerung mit nur 0.5 Prozent besteuern würde, dann hätten wir rund das fünffache Budget der jetzigen Entwicklungszusammenarbeit. Die Frage ist nur, ob eine solche Steuer kurzfristig umsetzbar ist. Natürlich muss man diese globalen strukturellen Ungleichheiten auch angehen. Aber deshalb Dinge nicht zu machen, die wir jetzt tun können, auch wenn in einem sehr viel kleineren Massstab, das ist für mich kein Argument.
Elísio Macamo: Mir scheint noch ein anderer Punkt wichtig. Politische Probleme sollten vor Ort artikuliert werden und nicht ausserhalb. Die Schweiz und andere Länder machen sich zu politischen Akteuren in Mosambik und anderswo, wenn sie dort mit ihrer Finanzkraft zum Beispiel Arbeitsbedingungen verändern wollen. Zudem lautet die Hypothese von Entwicklungsorganisationen meist, dass sie Probleme bekämpfen, die vor ihnen da waren. Doch in den letzten 30 bis 40 Jahren beschäftigt sich der Entwicklungsapparat vor allem mit Problemen, die er selbst geschaffen hat.
Können Sie ein Beispiel dafür nennen?
Elísio Macamo: Infolge von Verbesserungen im Gesundheitsbereich leben wir heute länger, wir haben weniger Krankheiten und werden immer mehr. Das braucht Infrastruktur und Arbeitsplätze. Das können wir aus eigener Kraft nicht schaffen. Das mag nun malthusianisch klingen, aber wir können nicht so tun als ob die Entwicklungszusammenarbeit nur dazu da ist, um Probleme zu lösen, die andere geschaffen haben. Das finde ich naiv. Entwicklungserfolge schaffen neue Probleme, die dann wiederum bewältigt werden müssen.
Ist das nun ein Plädoyer dafür, die Hände komplett von der Entwicklungszusammenarbeit zu lassen?
Elísio Macamo: Nein, aber es braucht ein anderes Verständnis dafür, was wir mit Entwicklungszusammenarbeit überhaupt schaffen. Heute herrscht oft noch die Vorstellung vor, dass der Entwicklungsapparat nur dazu da ist, Probleme zu lösen, die «die Afrikaner» selbst geschaffen haben. Aber so ist es nicht; seit 500 Jahren ist es nicht mehr so.
Frau Günther, stimmen Sie mit Herrn Macamo überein? Brauchen wir ein neues Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit?
Isabel Günther: Ich möchte an dieser Stelle doch gerne auf den historisch einzigartigen Rückgang der globalen Kindersterblichkeit über die letzten 50 Jahre hinweisen. Das ist ein Fortschritt und kein zusätzliches Problem. Keine Mutter der Welt will mit ansehen müssen, wie ihr Kind stirbt. Natürlich ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, welche Dynamiken man durch bestimmte Interventionen auslöst. Aber das ist nichts Spezifisches für die Entwicklungszusammenarbeit. Ich stimme Herrn Macamo jedoch zu, dass die europäische Entwicklungszusammenarbeit nicht afrikanische Herausforderungen lösen kann, sondern dass wir alle sowohl Ursache als auch Lösung der grössten globalen Probleme sind.
Kommen wir auf die «Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021-2024» zu sprechen, die letztes Jahr vom Parlament verabschiedet wurde. Während der Vernehmlassung wurde die neue Ausrichtung von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen kritisiert. Herr Macamo, wie beurteilen Sie diese Strategie?
Elísio Macamo: Ich finde sie ein wenig seltsam. Zum Beispiel will man dort Ursachen für die Migration und Flucht bekämpfen. Aber wieso muss man Migration bekämpfen? Vielleicht ist sie ja auch eine Lösung für Länder wie Mosambik oder den Senegal. Europa hat sich auch entwickelt, indem die Armen und Jungen die Möglichkeit hatten auszuwandern. Aktuell haben wir einen Krieg im Norden von Mosambik. Ein Grund dafür ist, dass viele Junge ohne Perspektiven dort nicht weggehen können. Mir ist bis heute nicht klar, weshalb Migration hier in der Schweiz in erster Linie ein Problem sein soll.
Frau Günther, was halten Sie von der Strategie, Entwicklungszusammenarbeit zur Minderung von Migration einzusetzen?
Isabel Günther: Das ist aus verschiedenen Gründen problematisch: Entwicklung ist die Freiheit ein selbstbestimmtes Leben zu führen – und dazu gehört auch die Mobilität. Aus ökonomischer Perspektive gibt es ausserdem keine Intervention, die effektiver ist um Armut zu reduzieren, als die Migration.
Das müssen Sie erklären.
Isabel Günther: Studien haben gezeigt, dass der wichtigste Grund für Chancenungleichheit unsere Nationalität ist. 60 Prozent der globalen Einkommensunterschiede kommen alleine durch den Geburtsort zustande. 20 Prozent hängen von der ökonomischen Situation des Elternhauses ab. Und nur 20 Prozent werden bestimmt durch die eigene Arbeit, die Bildung und weitere persönliche Faktoren. Deshalb ist Migration so effektiv: Mit derselben Ausbildung und Arbeit kann jemand in einem anderen Land ein sehr viel höheres Einkommen generieren. Entwicklungszusammenarbeit sollte Migration so begleiten, dass sie die positivsten Effekte für alle hat. Solche Ansätze finden sich ja teils auch in der Strategie 2021-2024. Aber von der Idee, Migration durch Entwicklungszusammenarbeit zu reduzieren, davon sollte man sich verabschieden.
Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Strategie ist die stärkere Kopplung von Entwicklung und der «Innovationskraft und Expertise des Privatsektors». Wo sehen Sie Chancen und Risiken solcher öffentlich-privater Kooperationen?
Isabel Günther: Natürlich ist Kooperation bei der Bewältigung vieler Herausforderungen sehr sinnvoll. Ein aktuelles Beispiel ist die Erforschung, Produktion, Verteilung und Anwendung eines Impfstoffs gegen Covid-19. Es ist einleuchtend, dass alle Akteure eine wichtige Rolle spielen und mitmachen müssen – die Wissenschaft, die Privatwirtschaft, die Staaten sowie die Zivilgesellschaft. Ein Risiko sehe ich jedoch darin, dass der Fokus auf den Privatsektor zur verdeckten Exportförderung für die Schweiz wird. Dafür sollten keine Entwicklungsgelder eingesetzt werden.
Die neue Strategie legt zudem einen Fokus auf die Evaluation von Wirkung. Führt mehr Wissenschaftlichkeit automatisch zu einer effektiveren Entwicklungszusammenarbeit?
Isabel Günther: Die Forderung nach mehr Evidenz sollte nicht darin münden, dass man von jedem einzelnen Entwicklungsprojekt die Wirksamkeit misst. Das ist weder machbar noch sinnvoll. Es sollte vielmehr darum gehen, bestehende wissenschaftliche Evidenz zu nutzen, um Entwicklungszusammenarbeit in Hinblick auf die Verbesserung von Lebensbedingungen effektiver zu gestalten.
Elísio Macamo: Der Ruf nach mehr Evaluation ist die Folge einer andauernden politischen Diskussion darüber, dass Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit verschwendet werden. Ich gebe Frau Günther zwar recht: Es ist legitim, die Wirkung der eingesetzten Gelder zu evaluieren. Nur wird die Entwicklungszusammenarbeit dadurch auch ständig in Frage gestellt und man reduziert die Ziele alleine auf Effizienz. Effektivität und Wirkung hingegen sind oft schwieriger zu messen. Zu was das führen kann, sehen wir in Grossbritannien. Dort macht der Entwicklungsapparat nur noch, was sich gut messen lässt. Ob die Programme für die Menschen, denen geholfen werden soll, wichtig sind, spielt dabei keine Rolle mehr.
Isabel Günther: Solche Entwicklungen sollten aber nicht als Ausrede dienen, um bestehendes empirisches Wissen zu ignorieren. Es ist unsere Pflicht, wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen, genauso wie in anderen Politikbereichen auch. Insbesondere, weil die verfügbaren Gelder stark limitiert sind.
ISABEL GÜNTHER ist Professorin für Entwicklungsökonomie an der ETH Zürich und seit 2014 Direktorin des NADEL, das Hochschulabgänger für die Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit ausbildet. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich vor allem mit der Messung von Armut und Ungleichheit sowie der Effektivität von Politiken und Technologien zur Armutsbekämpfung. Sie hat in Benin, Burkina Faso, Äthiopien, Ghana, Kenia, Uganda und Südafrika geforscht.

ELÍSIO MACAMO ist Professor für Soziologie mit Schwerpunkt Afrika an der Universität Basel. Zuvor lehrte er Entwicklungssoziologie an der Universität Bayreuth, wo er Gründungsmitglied der «Bayreuth International Graduate School of African Studies» war. Für den «Council for the Development of Social Science Research in Africa» in Dakar (Senegal) bietet er regelmässig methodologische Workshops für afrikanische Doktoranden an.

Wir freuen uns auf ihren Besuch. Weitere Infos